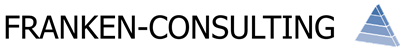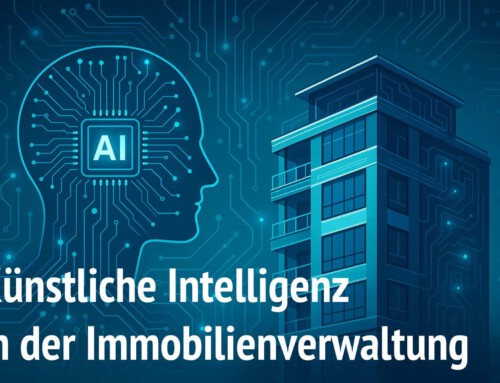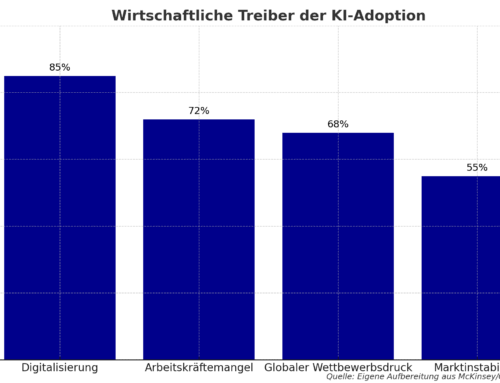Chancen nutzen – nur mit versierter Unterstützung wird die Problemimmobilie wieder rentabel
Die Entwicklung und Bewirtschaftung von Immobilien ist über viele Jahre ein verlässlicher Anker für Anleger und Eigennutzer gewesen. In den letzten Jahren haben sich jedoch die Rahmenbedingungen spürbar verändert. Ein Mix aus makroökonomischen, regulatorischen und technologischen Faktoren hat dazu geführt, dass immer mehr Gebäude den Status „Problemimmobilie“ erlangen. Als international tätige Unternehmensberatung für Immobilien begleiten wir Eigentümer, Investoren und Bestandshalter auf dem Weg aus der Krise. In diesem Artikel analysieren wir die Ursachen, Diagnose‑Methoden und Lösungswege für Problemimmobilien. Die folgenden Kapitel vermitteln praxisnahes Wissen und laden zur Kontaktaufnahme ein.
Grundproblem
Problemimmobilien sind Objekte mit strukturellem Leistungsdefizit. Sie generieren entweder unzureichende oder negative Cashflows, weisen hohen Instandhaltungs‑ oder (ESG‑)Sanierungsstau auf und verlieren durch veränderte Marktbedingungen an Wert. In Deutschland hat sich diese Entwicklung in den vergangenen Jahren verstärkt. So lag das Transaktionsvolumen im gewerblichen Immobilienbereich 2024 bei etwa 35,3 Mrd. € und damit deutlich unter dem Zehnjahresdurchschnitt. Parallel dazu ist der Leerstand gewerblicher Flächen in den 127 von uns beobachteten Städten um über 14 % auf knapp 11 Mio. m² gestiegen. Diese Kennzahlen verdeutlichen, dass sich das Marktumfeld fundamental verändert hat.
Kapitalmarktzinsen und Finanzierung
Ein wesentlicher Grund für die wachsende Zahl von Problemimmobilien ist das gestiegene Zinsniveau. Nach jahrelanger Niedrigzinsphase erhöhte die Europäische Zentralbank ab 2022 mehrfach die Leitzinsen. Obwohl inzwischen eine leichte Entspannung erkennbar ist, bleiben Kredite für gewerbliche Immobilien teurer und restriktiver. Die Deutsche Bundesbank meldete im Bank Lending Survey für Q2 2025 eine Netto‑Verschärfung der Kreditstandards für Unternehmenskredite um +3 %. Gleichzeitig sind Banken bei der Finanzierung energieineffizienter Objekte zurückhaltend. Eigentümer ohne ausreichende Liquidität geraten so leicht in eine Finanzierungssackgasse – ein erster Schritt auf dem Weg zur Problemimmobilie.
Nachfragewandel bei Nutzern
Veränderte Nutzergewohnheiten und Megatrends – allen voran Homeoffice, E‑Commerce und Digitalisierung – sorgen für strukturelle Leerstände. Laut JLL betrug die Leerstandsquote im Bürosegment der deutschen Big‑7‑Städte im ersten Halbjahr 2025 7,7 %, während rund 7,6 Mio. m² kurzfristig verfügbar waren. Gleichzeitig sanken die Spitzenmieten im Einzelhandel 2024 um durchschnittlich 2,1 % in 1a‑Lagen. Wer sein Geschäftsmodell auf stationären Einzelhandel oder traditionelle Großraumbüros stützte, muss sich heute völlig neuen Bedarfsprofilen stellen.
ESG‑Regulierung
Die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft betrifft auch die Immobilienbranche. Strenge Anforderungen aus der EU‑Taxonomie und dem Gebäudeenergiegesetz zwingen Eigentümer, energetische Sanierungen vorzunehmen. Investitionen in die Gebäudehülle, in Heizung, Lüftung und Dämmung sind zwar langfristig wertsteigernd, erfordern aber erhebliche finanzielle Mittel. Förderprogramme wie das KfW‑Programm 263 für Nichtwohngebäude bieten Tilgungszuschüsse bis zu 35 %, doch ohne solide Planung können derartige Projekte zum finanziellen Bumerang werden.
So wird eine Immobilie zur Problemimmobilie
Eine Immobilie wird selten über Nacht zum Problemfall; es ist meist ein schleichender Prozess. Vier Faktoren wirken in unterschiedlichen Kombinationen zusammen:
- Ertragsdefizit: Sinkende Mieten, steigender Leerstand und ausbleibende Neuvermietungen lassen die operativen Einnahmen schmelzen. Der Cashflow ist nicht mehr ausreichend, um Betriebskosten, Instandhaltung und Zinslast zu decken.
- Technischer Zustand: Fehlende Instandhaltung führt zu baulichen Mängeln. Eine veraltete Haustechnik oder eine schlechte Energieeffizienz erfordern teure Sanierungen und schrecken potenzielle Nutzer ab.
- Marktmissmatch: Standort und Nutzungsart passen nicht mehr zur Nachfrage. Ein Bürogebäude in einer Peripherielage ohne öffentliche Anbindung oder ein Warenhaus in einer vom Onlinehandel dominierten Innenstadt verliert seine Funktion.
- Finanzierungslücke: Zinsbindungen laufen aus, Covenants werden verletzt, Banken reduzieren das Beleihungsausmaß. Ohne frisches Eigenkapital oder alternative Finanzierungsquellen droht der Gang in die Zwangsversteigerung.
Diese Faktoren verstärken sich gegenseitig. Ein niedriger Energieeffizienzstandard führt zu höheren Betriebskosten, was Mietinteressenten abschreckt. Sinkende Erträge verringern die Objektbewertung und erschweren die Finanzierung. So entsteht der berühmte „Teufelskreis“.
Diagnosemöglichkeiten
Der Weg aus der Problemzone beginnt mit einer schonungslosen Bestandsaufnahme. Erfolgreiche Turnarounds beginnen stets mit einem strukturierten Diagnostikprozess, der folgende Bausteine umfasst:
- Commercial Due Diligence (CDD): Analyse der Mietverträge, Laufzeiten, Mieterbonität und Nebenkosten. Wie hoch sind die Ist‑Mieten im Vergleich zur Marktmiete? Gibt es auslaufende Verträge oder Kündigungsrechte? Welche Incentives wurden vereinbart?
- Technische Due Diligence (TDD): Erfassung des baulichen Zustands einschließlich der Gebäudetechnik. Dies umfasst die Prüfung von Dach, Fassade, Fenster, Heizung, Lüftung, Aufzügen und IT‑Infrastruktur. Ein Energieaudit ermittelt den energetischen Ist‑Zustand und die Investitionsbedarfe.
- ESG‑Check: Prüfung der Umwelt‑, Sozial‑ und Governance‑Kriterien. Ist das Gebäude taxonomiekonform? Erfüllt es die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes? Gibt es Zertifizierungen (DGNB, LEED, BREEAM)?
- Rechtliche und steuerliche Prüfung: Klärung von Baurechten, Erbbaurechten, Grundbucheinträgen, Altlasten und Verträgen mit Dienstleistern. Eine saubere Grundbuch‑ und Vertragslage ist für die Umsetzung von Sanierungen und Nutzungsänderungen entscheidend.
- Finanzanalyse: Betrachtung der aktuellen Finanzierungsstruktur, Laufzeiten, Covenants und Zinsbindungen. Hier zeigt sich, ob kurzfristiger Handlungsbedarf besteht.
Moderne Softwarelösungen ermöglichen es, diese Diagnosedaten in digitalen Dashboards zu visualisieren, sodass Entscheidungsträger einen schnellen Überblick über die „Baustellen“ erhalten.
Jede gewerbliche Immobilie ist eine Wertschöpfungskonfiguration und deshalb ein Geschäftsmodell
Im Kern ist eine vermietete Immobilie ein produktives Asset, das ein Geschäftsmodell abbildet. Ein Bürohaus stellt Mietern Flächen bereit, die für deren Wertschöpfung essenziell sind. Ein Hotel verkauft Übernachtungen, ein Einkaufszentrum vermietet Verkaufsflächen an Einzelhändler. Jedes dieser Geschäftsmodelle setzt sich aus Ressourcen (Gebäude, Lage), Aktivitäten (Vermietung, Service), Partnern (Mieter, Dienstleister, Banken), Kostenstruktur und Ertragsflüssen zusammen. Wenn eine dieser Komponenten nicht mehr funktioniert, gerät das Geschäftsmodell ins Wanken.
Der strukturelle Wandel bedeutet, dass erfolgreiche Modelle von gestern morgen nicht mehr funktionieren. Ein Lagerhaus ohne digitale Lieferkette ist genauso ein Problem wie ein Retail‑Objekt ohne Erlebnis‑Konzept. Immobilieninvestitionen müssen sich daher zunehmend an der logischen Analyse von Geschäftsmodellen orientieren. Wer die Immobilie als dynamisches Wertschöpfungssystem versteht, erkennt frühzeitig, wo Anpassungen nötig sind.
Geschäftsmodelle haben Verfallsdaten
In der Tech‑Branche gelten Produktlebenszyklen von wenigen Jahren; Immobilien galten früher als „Ewigkeitsinvestitionen“. Diese Annahme gilt nicht mehr. Die Nutzungsdauer von Bürogebäuden, Hotels oder Einkaufszentren wird heute durch Markttrends, ESG‑Anforderungen und Technologiezyklen begrenzt. Der „Verfallszeitpunkt“ eines Immobiliengeschäftsmodells tritt ein, wenn die erwarteten Erträge dauerhaft hinter den Kapitalkosten zurückbleiben, der Investitionsbedarf die Eigentümer überfordert oder die Immobilie vom Nutzer nicht mehr akzeptiert wird.
Unsere Daten zeigen, dass Prime‑Retailmieten in Toplagen bereits 2024 um 2,1 % gesunken sind. Diese Entwicklung ist ein Indikator dafür, dass das Geschäftsmodell „innerstädtischer Einzelhandel“ in seiner bisherigen Form veraltet sein könnte. Auch der starke Anstieg der Büroleerstände deutet darauf hin, dass klassische Büroflächen ohne flexibles Konzept einen „Verfall“ erleben.
Die wichtigste Aufgabe für Eigentümer ist es, das Verfallsdatum nicht passiv abzuwarten, sondern rechtzeitig eine Transformation einzuleiten. Wer früh handelt, kann seine Immobilie in ein zukunftssicheres Geschäftsmodell überführen.
Was kann getan werden?
Die Sanierung einer Problemimmobilie erfordert ein ganzheitliches Maßnahmenpaket. Dieses umfasst ökonomische, technische und kommunikative Elemente:
Sanierungs‑ und Repositionierungsstrategie
- Light Repositioning: Hierbei handelt es sich um kosmetische Maßnahmen wie neue Bodenbeläge, Beleuchtungskonzepte, Wegweisungssysteme und kleinere Grundrissoptimierungen. Ziel ist es, den ersten Eindruck zu verbessern und kurzfristig neue Mieter zu gewinnen. Solche Eingriffe kosten typischerweise 3–8 % des Objektwerts.
- ESG‑Sanierung: Um ein Gebäude nachhaltig aufzuwerten, sind energetische Maßnahmen notwendig. Dazu gehören die Erneuerung der Fassade, der Austausch von Fenstern, die Dämmung von Dach und Keller sowie die Modernisierung von Heizung und Lüftung. Hier bewegen sich die Budgets meist zwischen 12 % und 25 % des Objektwerts. Förderkredite wie das KfW‑Programm 263 bieten Tilgungszuschüsse zwischen 5 % und 35 %.
- Deep Refurb / Mixed‑Use: Bei gravierenden Problemen ist eine umfassende Umnutzung oder Kernsanierung erforderlich. Dabei wird das Objekt teilweise entkernt, Flächen neu geordnet und auf neue Nutzungen ausgerichtet (z. B. Büro zu Wohnen oder Einzelhandel zu Gesundheitszentrum). Die Kosten liegen hier häufig zwischen 25 % und 40 % des Objektwerts. Solche Projekte dauern 18–36 Monate und erfordern professionelle Projektsteuerung.
Vermietungs‑ und Nutzungskonzept
Die beste Sanierung nutzt nichts, wenn das Nutzungskonzept nicht zur Nachfrage passt. Ein entscheidender Schritt besteht darin, Zielmietergruppen zu identifizieren und das Nutzungskonzept entsprechend auszurichten. Im Bürosegment bedeutet das häufig eine Kombination aus klassischen Mietern, Co‑Working‑Anbietern, Bildungs‑ oder Gesundheitsinstitutionen. Im Einzelhandel liegt die Zukunft in der Kombination von Einkauf, Gastronomie, Freizeit und Dienstleistungen. Mixed‑Use‑Konzepte erhöhen die Frequenz und reduzieren die Abhängigkeit von einzelnen Branchen.
Projektmanagement und Kommunikation
Revitalisierungsprojekte erfordern eine professionelle Projektsteuerung (Project Management Office), die alle Gewerke koordiniert, Budgets überwacht und Stakeholder informiert. Eine transparente Kommunikation mit Mietern, Banken, Kommunen und Behörden ist entscheidend. Banken sollten frühzeitig über Pläne informiert werden, um Covenant‑Anpassungen zu verhandeln oder finanzielle Brücken zu bauen.
Externe Expertise vs. Inhouse
Kleinere Objekte können mit einem erfahrenen Inhouse‑Team revitalisiert werden. Bei komplexen Sanierungen und Umnutzungen ist jedoch die Einbindung externer Spezialisten sinnvoll. Dazu gehören Vermietungsexperten, TGA‑Ingenieure, ESG‑Berater, Finanzierer sowie Rechts‑ und Steuerexperten. Sie bringen Marktkenntnis, technisches Know‑how und Verhandlungskompetenz ein, die für den Turnaround unerlässlich sind.
Welche Budgets sind erforderlich und wer gibt Geld?
Die Kosten variieren je nach Ausgangszustand, Standort und Nutzungsart. Orientierungswerte aus der Praxis:
| Maßnahme | Investitionsspanne (% des Objektwerts) | Zeitrahmen | Mögliche Finanzierung |
|---|---|---|---|
| Leichte Repositionierung | 3 – 8 % | 6 – 12 Monate | Eigenkapital, Senior Debt |
| ESG-Sanierung | 15 – 25 % | 12 – 24 Monate | Eigenkapital, KfW‑Programm, Bankfinanzierung |
| Deep Refurb / Mixed‑Use | 25 – 40 % | 18 – 36 Monate | Eigenkapital, Mezzanine, Private Debt, Fördermittel |
Eine realistische Budgetierung umfasst neben den Baukosten auch Planungshonorare, Genehmigungsgebühren, Umzugskosten, Marketing und Finanzierungszinsen. Unsere Erfahrung zeigt, dass eine Projektausfallreserve von 10 % eingeplant werden sollte.
Finanzierungsquellen
- Hausbanken: Klassische Finanzierung über Banken bleibt möglich, sofern das Projekt nachvollziehbar ist und eine ESG‑Roadmap vorliegt. Das Bank Lending Survey zeigt jedoch, dass die Kreditstandards 2025 verschärft wurden.
- Mezzanine‑Kapital / Private Debt: Private Kreditfonds schließen Finanzierungslücken durch Nachrangdarlehen oder hybride Finanzierungsformen. Die Konditionen sind teurer, ermöglichen jedoch höhere Fremdfinanzierungsquoten.
- Öffentliche Förderprogramme: Die KfW und Landesförderbanken (z. B. NRW.BANK) unterstützen energetische Sanierungen und Transformationsprojekte. Das KfW‑Programm 263 bietet Tilgungszuschüsse von bis zu 35 % bei Laufzeiten bis 30 Jahren.
- Eigenkapital und Family Offices: Gerade bei opportunistischen Turnarounds sind Joint Ventures mit privaten Investoren ein geeigneter Weg. Diese sind bereit, höhere Risiken zu tragen und profitieren im Gegenzug von höherem Upside‑Potenzial.
- Forward‑Sale / Forward‑Funding: Wie im vorigen Abschnitt erläutert, kann ein Forward‑Sale genutzt werden, um ein in der Sanierung befindliches Projekt bereits vor Fertigstellung zu verkaufen. Die Eigentumsübertragung erfolgt erst nach Abschluss der Arbeiten; der Käufer trägt dadurch kein Bau‑ oder Insolvenzrisiko.
Sonstige Aspekte
Neben den Kernthemen gibt es weitere Punkte, die bei Problemimmobilien Beachtung finden sollten:
- Steuerliche Optimierung: Revitalisierungen können steuerlich begünstigt werden, insbesondere wenn Denkmalschutzauflagen vorliegen oder energetische Maßnahmen steuerlich absetzbar sind. Eine frühzeitige Abstimmung mit Steuerexperten ist ratsam.
- Kommunale Zusammenarbeit: Städte und Gemeinden haben ein Interesse an funktionsfähigen Immobilienstandorten. Fördermittel, Bebauungsplanänderungen oder Flächenneuzuschneidungen können nur in Abstimmung mit den Behörden erfolgen.
- Nachhaltigkeit und ESG: Die Nachfrage nach nachhaltigen Immobilien wächst rasant. Gebäude mit hohen Energie‑ und Klimastandards erzielen geringere Betriebskosten, höhere Mieten und sind leichter finanzierbar. Die Transformation in Richtung ESG ist daher nicht nur eine regulatorische Pflicht, sondern eine wirtschaftliche Chance.
- Technologieeinsatz: Intelligente Gebäudeleittechnik, Sensorik und digitale Plattformen erhöhen die Attraktivität für Mieter. Zudem ermöglichen Datenanalysen eine bessere Steuerung des Gebäudebetriebs und erleichtern das Monitoring von ESG‑Kriterien.
Fazit und Einladung zur Beratung
Problemimmobilien sind kein Schicksal, sondern das Ergebnis mangelnder Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen. Die Herausforderungen – steigende Zinsen, Nachfragewandel, ESG‑Auflagen – sind komplex, aber nicht unlösbar. Entscheidend ist, frühzeitig zu handeln: Eine fundierte Diagnose, ein belastbares Sanierungskonzept und die Einbindung der richtigen Partner machen aus Problemobjekten wieder stabile Wertanlagen. Unsere Unternehmensberatung unterstützt Sie dabei, die optimalen Lösungen für Ihr Objekt zu entwickeln und umzusetzen.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf, wenn Sie eine problembehaftete Immobilie besitzen oder ein Investment vor der Krise bewahren möchten. Wir kombinieren technisches Know‑how, wirtschaftliche Expertise und ein starkes Netzwerk aus Architekten, Ingenieuren, Finanzierern und Juristen. Gemeinsam verwandeln wir Problemimmobilien in nachhaltige Erfolgsprojekte.